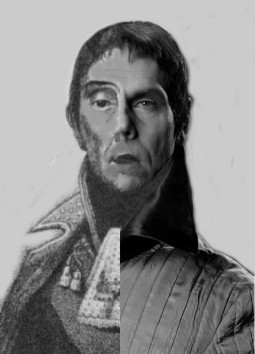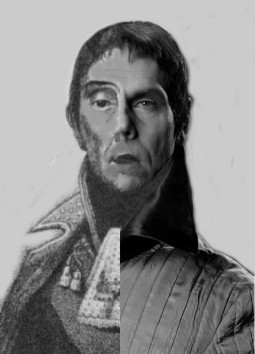BEWERBUNGEN
von Rolf
Schneider
PROJEKTBESCHREIBUNG
Der
Autor benutzt für
seinen Monolog aus 14 Szenen die Biografie von Joseph Fouché.
Joseph
Fouché (geb. 21. Mai 1759 in Le
Pellerin, nahe Nantes, gest. 26. Dezember 1820 in Triest, damals
Österreich) war Sohn eines Kapitäns der Handelsmarine.
Mitglied des Ordens der Oratorianer, Lehrer der Logik und der Physik,
mit Beginn der französischen Revolution in Nantes Mitglied der
Gesellschaft der Verfassungsfreunde.
1792
in den Konvent
gewählt, Mitglied der radikalen Bergpartei, Befürworter der
Hinrichtung Ludwigs des XVI. im Januar 1793. Beauftragter im Kampf
gegen Royalismus und gemäßigte republikanische Gesinnung,
im November 1793 „Der Schlächter von Lyon“.
Konflikt
mit Robespierre,
der ihn aus dem Jakobinerclub, dessen Präsident F. war,
ausschließen lässt. Fouché betreibt heimlich die
Hinrichtung R.s, war aber offiziell daran nicht beteiligt.
1797
Beteiligung am
Staatsstreich.
1799
zum Polizeiminister
ernannt befördert er den Staatsstreich Napoleons und wird als
dessen Erster Konsul unentbehrlich. Er organisiert ein ausgedehntes
Spionagesystem über alle Klassen der Gesellschaft. 1802 als
Polizeiminister abgesetzt, aber mit mehr als 2 Millionen Franc zu
Reichtum gekommen.
Unter
dem Kaisertum
Napoleons 1804 erneut Polizeiminister, 1809 Herzog von Otranto mit
beträchtlichen Liegenschaften. Infolge geheimer Verhandlungen
mit England gegen die Eroberungszüge Napoleon 1810 wieder
abgesetzt. Er vernichtet alle wichtigen Unterlagen und flieht nach
Italien.
1811
Rückkehr nach
Paris, Intrigen gegen Napoleon für die Regentschaft von dessen
Frau.
1814
schließt er
sich – nach Napoleons Abdankung – der neuen Bourbonen-Herrschaft
an (Ludwig XVIII.), befördert aber zugleich die Rückkehr
Napoleons von Elba, der ihn wieder als Polizeiminister einsetzt.
1815
– nach der zweiten
Abdankung Napoleons – als Vorsitzender der provisorischen Regierung
bereitet Fouché die Restauration der Bourbonen vor.
Gestorben
1820 in Triest
in der Verbannung.
Seine
Söhne ziehen
sich mit 14 Millionen Francs 1820 nach Schweden zurück, wo der
Zehnte Herzog von Otranto und die Grafen Fouche´ d’Otranto
noch heute leben.
Das
Faszinierende an
dieser Biografie besteht darin, dass es Joseph Fouché in einer
politisch bewegten und bewegenden Zeit immer wieder gelingt, auf die
Seite der Mächtigen zu gelangen.
BEWERBUNGEN
von Rolf
Schneider
PROJEKTBESCHREIBUNG
Blatt
2
Balsac
in „Eine dunkle
Geschichte“:
Fouchés
besonderes
Genie, das Napoleon eine Art Schrecken einjagte, zeigte sich bei ihm
nicht auf einmal. Dieses unbekannte Konventsmitglied, einer der
außerordentlichsten und damals am falschesten beurteilten
Männer, hatte sich in den Stürmen der Zeit entwickelt.
Unter dem Direktorium stieg er zu jener Höhe auf, von der aus
tiefveranlagte Menschen, indem sie sich ein Urteil über die
Vergangenheit bilden, die Zukunft zu erkennen vermögen; und dann
gab er plötzlich – wie gewisse mittelmäßige
Schauspieler, die, durch ein unerwartetes Licht erleuchtet,
überragend werden – während der schnell vorübergehenden
Revolution
des 18.
Brumaire Beweise seiner Geschicklichkeit. Dieser blassgesichtige
Mensch, der, in klösterlicher Verstellung aufgewachsen, die
Geheimnisse der Bergpartei, der er angehörte, und auch die der
Royalisten, denen er sich zuletzt anschloß, kannte, hatte in
der Stille und mit Bedacht Menschen, Dinge und Interessen der
politischen Bühne studiert.
Das
ist ohne Frage ein
interessante frühbürgerliche (spätfeudale) Biografie
auf
der Ebene der
Mächtigen, aber sie ist auch auf den ersten Blick voller Assoziationen
zu Ereignissen und Verhaltensweisen zweihundert Jahre
später.
Die
Theaterfigur Joseph
Fouché trifft über einen Zeitraum von etwa dreißig
Jahren auf unterschiedlichste – vorgestellte oder im Zuschauerraum
angenommene – Partner, mit denen sie ihre Meinungen, Urteile und
Vorgehensweisen bespricht und bei denen sie ihre Ansprüche
durchsetzt. Seine alleinige Anwesenheit macht große Intimität
möglich, so dass über die Person sehr viel zu erfahren ist.
So
wie Balsac jede
moralische Verurteilung der Figur vermeidet, will auch die
Inszenierung vorgehen. Die vom Zuschauer zu beurteilenden Fakten
werden in den Texten ausgebreitet und dem Urteil ausgeliefert.
Von
großem Interesse
aber sind die Mittel, die Taktiken und Strategien Fouchés, mit
denen er seine Position immer wieder sichert und erobert. Das
erkennbar und durchschaubar zu machen, ist der Interessenpunkt der
Inszenierung: Die Methoden Fouchés werden durch spielerisches
Vorgehen auf ihre Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit geprüft
und zur möglichen Verwendung frei gegeben. Das schließt
eine moralische Bewertung der Methoden durch die Inszenierung aus.
Ohne
durch platte
Aktualisierung oder durch Eingriffe in den Text den Zuschauer nicht
nur für die historische Biografie, sondern für einen Blick
von heute auf die möglichen Strategien bei der Bemühung um
eine Position zu animieren, benutzt die Inszenierung einen Trick, der
so beim Autor nicht vorgesehen ist:
BEWERBUNGEN
von Rolf
Schneider
PROJEKTBESCHREIBUNG
Blatt
3
Der
Schauspieler befindet
sich als eine andere Figur als Fouché im Wartesaal eines
Arbeitsamtes (möglicherweise ein ehemaliger Geschichtslehrer
oder -professor) und ist dort bei der Zeitungslektüre
vergessen und – wie sich herausstellt – eingeschlossen worden. Er
vertreibt sich die Nacht damit, dass er biografische Ausschnitte aus
dem Leben Fouchés durchspielt, der gleich ihm immer wieder
genötigt war, um seine Existenz zu kämpfen. Dieses Vorgehen
ermöglich immer wieder die sinnvolle Reduzierung auf den
Warteraum, ermöglicht immer wieder den Neubeginn bei jeder
Szene, ermöglicht einen spielerischen Umgang mit der Figur, die
schon beim Lesen des Textes durch die teilweise großen
Zeitsprünge in jeder Szene eine völlig andere zu sein
scheint.
Der
Bühnenraum (also:
der angedeutete Warteraum) wird durch ein Arrangement von Stühlen
hergestellt. Die Stühle entsprechen im Wesentlichen den Stühlen,
auf denen auch die Zuschauer sitzen. Das Kostüm ist „zeitlos“,
also auf jeden Fall nicht historisch. Requisiten und Accessoires
(auch anachronistische, also historische) werden sparsam benutzt.
Auf
das Zitieren
historischer Musik wird verzichtet werden, aber eine Collage aus
Geräuschen und Klängen kann die Situation (einer ist allein
in einem fremden Raum eingeschlossen) unterstützen und dem Spiel
zu einem Rhythmus verhelfen.
Der
Autor nennt den
Monolog Komödie.
Wenn
die Komödie
einerseits aus dem „verkehrten“ Blick (also dem Blick, der auf
dem Kopf steht) auf die Dinge und Ereignisse besteht und andererseits
die Komödie als Dramenform die Lösung des ihr immanenten
Konflikts auf die Zeit nach dem Ende des Dramas verweist, so kann die
komische Wirkung darin bestehen, dass innerhalb der Szenen die Fakten
und Beurteilungen von der Fouché-Figur immer wieder ins
Gegenteil verkehrt werden und dass in der letzten Szene Fouché
sich bei der Instanz (bei „Gott“) als Polizeiminister anbietet,
die aus moralischen Gründen am wenigsten „geeignet“ sein
müsste - die Verkehrung quasi eine doppelte ist.
Erkennen
und Lachen über
das Verhalten dieser streitbaren Figur sind gut geeignet, zu
entdecken, wie man selbst mit Ängsten umgeht und wie
verantwortlich jeder für das ist, was er tut.
BEWERBUNGEN
von Rolf
Schneider
ANMERKUNGEN
ZUM AUTOR
Geboren
1932
1955
bis 1958 Studium der
Germanistik und Pädagogik an der Universität
Halle-Wittenberg.
Redakteur
der
kulturpolitischen Zeitschrift „Aufbau“ in Berlin.
Seit
1958 freischaffender
Schriftsteller.
Zahlreiche
Hörspiele
und Theaterstücke, am bekanntesten „Einzug ins Schloß“.
Im
November 1876
Mitunterzeichner der Protestresolution von DDR-Autoren gegen die
Ausbürgerung Wolf Biermanns.
1979
Ausschluß aus
dem Schriftstellerverband der DDR.
Theaterautor
und Dramaturg
in Mainz und Nürnberg.
Mitglied
des PEN-Zentrums
der Bundesrepublik Deutschland.
Lebt
in Schöneiche
bei Berlin.
1995
„Die Briefe des
Joseph F.“, erschienen bei Katzengraben-Presse.
„Bewerbungen“
ist 1986
entstanden und 1990 im Henschel-Verlag (Reihe DIALOG) erschienen.